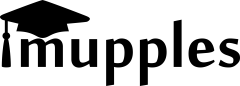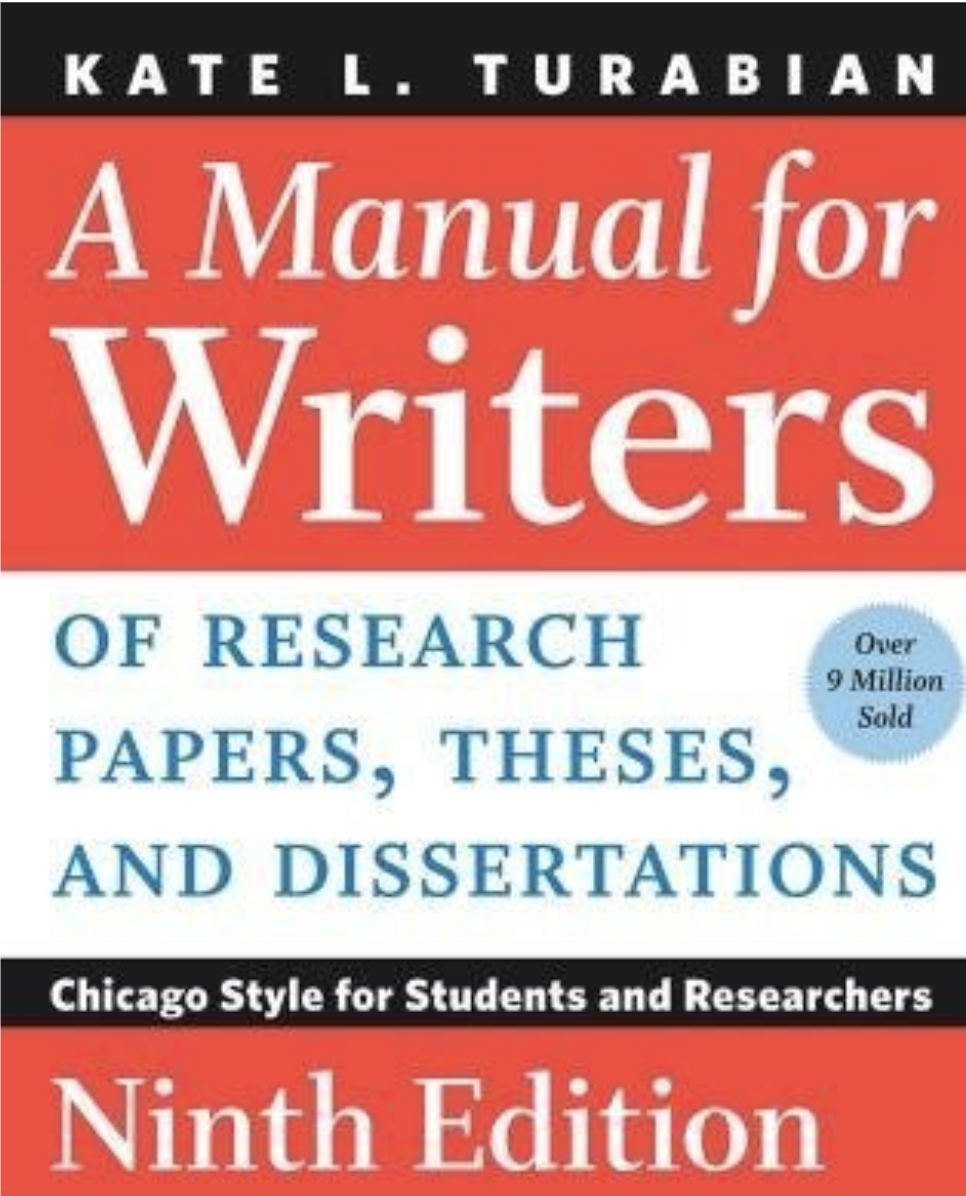Der letzte Blog-Post drehte sich um den Kardinalfehler Nummer eins: zu spät mit den Schreiben begonnen. Den Text deshalb nicht genügend ausmodelliert zu haben. Wegen Zeitknappheit ( ?) den Text nicht hinreichend genug vertieft zu haben. Eine Perfektionierung von Inhalt und Struktur war nicht mehr möglich. Time over. Abgabe. Viele Thesis-Mängel sind Folgen diese Paradefehlers.
Natürlich muß in einer Thesisarbeit, im Rahmen der Einführung, eine nachvollziehbare Darstellung und Abgrenzung der Problemstellung erfolgen. In aller Regel bedarf es einer Erläuterung warum das Thema nicht trivial ist, obwohl es sich vielleicht so anhört. Wo liegt bisher das Problem dieser Fragestellung?
Die gute Idee: das Reservoir füllen
Die Einführung gegen Ende der Thesis zu schreiben, ist nicht die schlechteste Idee. Warum? Genau diese Aspekte sind dann der Autorin, dem Autor bekannt, wenn – und das ist jetzt entscheidend – wenn, die dafür notwendige Unterlagen sorgfältig studiert wurden und erste selbständige Formulierungsversuche für einen eigenen Text gewissermassen “trainiert” wurden.
Um ja keinen Textschnipsel zu verlieren (Textschnipsel = Idee; wir könnten auch “Mem” sagen), empfehle ich, alle Textschnipsel, die zu einer Thesisarbeit gehören, in einer einzigen Datei zu sammeln. Diese Datei nenne ich der Einfachheit halber “Thesisfile”. So wird ein Zettelkasten vermieden und keine Idee, kein Mem geht verloren! Das Thesisfile ist zunächst ein Durcheinander, welches sich mit wiederholter Bearbeitung fast von selbst strukturiert, konsolidiert zum wertvollen Textreservoir wird.
Der Hauptvorteil besteht also aber darin, dass jetzt Textmaterial vorliegt, das bearbeitet werden kann, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Damit haben wir einen grundsätzlich anderen Sachverhalt, gegen über der Feststellung, noch keinen Text zu haben und jetzt aber schnell was produzieren zu müssen (weil ja das Ende naht 😟 ), mit der Konsequenz, dass der Überarbeitungsprozess zu kurz greift.
Der Kardinalfehler: die Idee vergessen

Notizen beim Studium der Quellen zu machen, bedeutet natürlich aktives Arbeiten. Das Thesisfile ist geöffnet und ich muss meinen Ideen darin festhalten. Ohne Disziplin und eisernen Willen geht das nicht: natürlich ist es einfacher das Buch – oder das Tablet – in angenehmer Umgebung (sagen wir mal in einem guten Café) offen zu haben und zu schmökern. Wo aber bleiben die Textkonserven? Lügen wir uns in die Tasche? “Das schreib ich später auf!”.
Vergessen Sie es! In aller Regel klappt das nicht! Und schon garnicht mit der ursprünglichen Ideentiefe oder dem ursprünglichen Erkenntnisgewinn.
Noch so ein Irrtum
Kommen wir zurück zum Kapitel Einführung und der nachvollziehbaren Darstellung und Abgrenzung der Problemstellung – typische Inhalte für das Kapitel Einführung. „Das ist doch sowieso bekannt…“ Mag sich manche/r denken? Vielleicht? Sicherlich – aber nicht von der/dem Thesisschreiber/in. Da interessiert es schon, wie verargumentiert das der Thesisschreiber oder die Thesisschreiberin? Zweifellos ein wichtiger Punkt in der Bewertung.
Die Lösung
Ganz konkret: hier müssen Ihre Überlegungen, Ihre Gedanken, Ihre Argumente, samt Gründe, im selbständig formulierten Text nachlesbar sein! Alleine darauf zu setzten, daß “dies doch sowieso bekannt ist“, hilft Ihnen als reine Annahme nicht weiter.
Fazit

Der in diesem Blog-Post angesprochene Kardinalfehler besteht also in einem suboptimalen Aufbau der Einführung in die Thesisarbeit. Häufig ist das ein Folgefehler aus dem zu späten Start mit dem aktiven Ringen um Texte.
Im Grunde ist Thesisschreiben einfach, weil es ja “nur” um die Textproduktion geht, auf wissenschaftlicher Grundlage zwar, es geht aber ausschliesslich um Text: seine Struktur (Aufbaustruktur) und den Inhalt (die Ablaufdynamik). Nicht mehr aber auch nicht weniger. Wenn Sie dabei das Forschungsinteresse Ihrer Betreuer/in treffen – um so besser.
Wenn Sie mehr Tipps und Tricks zu Thema suchen: Fortsetzung folgt. Auch das oben gezeigte Buch von Kate Turabian verät mehr. Vorgänger-Posts: read-this and that.
Die Kunst ein gute Thesis zu schreiben:
Have fun storming the castle
Ihr Prof. J. Anton Illik